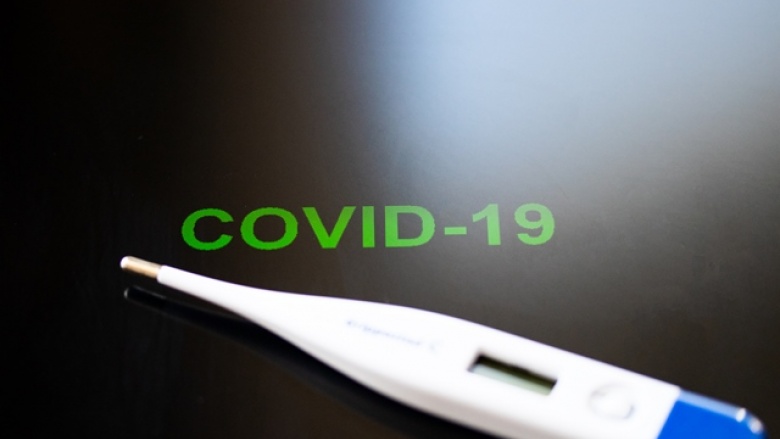
COVID-19
Mögliche Ansätze für Impfungen
Unser Immunsystem
Die körpereigene Abwehr, das Immunsystem, ist ein Schutzmechanismus gegen Krankheitserreger. Bei Kontakt mit einem Krankheitserreger bildet das Immunsystem Abwehrstoffe, so genannte Antikörper. Außerdem bildet der Körper Gedächtniszellen. Diese Gedächtniszellen können sich die Krankheitserreger „merken“, mit denen der Körper schon einmal Kontakt hatte. Beim nächsten Kontakt mit einem bekannten Krankheitserreger veranlassen die Gedächtniszellen schnell die Bildung von passenden Antikörpern. Dadurch wird der Erreger umgehend unschädlich gemacht.
Aktive Immunisierung durch Impfung
Der Körper bildet nicht nur durch eine Erkrankung Antikörper. Eine Immunität kann ohne Erkrankung durch eine Impfung erzeugt werden. Meist sind mehrere Impfungen notwendig, um einen Grundschutz aufzubauen. Nach einigen Jahren kann eine Auffrischungsimpfung notwendig sein. Die allermeisten Impfungen sind „Aktiv-Impfungen“.
Passive Immunisierung
Manchmal ist es notwendig, sofort einen Impfschutz zu erzielen. Bei der passiven Impfung werden die passenden Antikörper gespritzt. Der Schutz ist sofort vorhanden, hält jedoch nur einige Wochen. In diesem Fall bildet der Körper kein Gedächtniszellen.
Impfstoff-Klassen
- Lebendimpfstoffe bestehen aus abgeschwächten Krankheitserregern. Diese lösen eine Infektion aus. Die Infektion ist jedoch so schwach, dass die Krankheit nicht ausbricht. Beispiele sind Masern-, Mumps- und Röteln-Impfung.
- Totimpfstoffe enthalten inaktivierte oder abgetötete Erreger. Beispiele sind Grippe- und Tollwut-Impfungen.
- Komponenten- oder Subunit-Impfstoffe (nichtzelluläre Impfstoffe) enthalten nur die Bestandteile des Erregers, die gebraucht werden, um die Antikörperbildung auszulösen.
Ein Beispiel ist die Keuchhusten-Impfung.
- Konjugat-Impfstoffe sind Totimpfstoffe, bei denen Erregerbestandteile an Eiweißstoffe gekoppelt werden. Durch diese Kopplung kann die Immunreaktion verstärkt werden. Beispiel: Ein Impfstoff gegen Pneumokokken (Lungenentzündung).
- Toxine (Giftstoffe): Manche Krankheiten werden durch Giftstoffe ausgelöst, die der Erreger produziert. Beispiele sind Diphtherie und Wundstarrkrampf (Tetanus). Geimpft wird in diesem Fällen mit inaktiviertem Toxin.
- Rekombinante Impfstoffe: Ein einziges Merkmal (Antigen) der Oberfläche eines Erregers kann ausreichen, damit das Immunsystem Antikörper bildet.
Diese Merkmale können im Labor künstlich produziert werden. Beispiele sind die Impfstoffe gegen Hepatitis A und B.
COVID-19
- SARS-CoV-2 ist ein neuartiges Coronavirus.
- SARS steht hierbei für “Schweres Akutes Atemwegssyndrom”.
- Die Erkrankung, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird, heißt COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).
Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark: Es gibt Infektionen ohne Krankheitszeichen. Es können aber auch schwere Lungenentzündungen mit Lungenversagen und Beteiligung anderer Organe (z.B. Herz, Gehirn, Niere) auftreten, die zum Tode führen können.
Entwicklung neuer Impfstoffe
Einen wirksamen und sicheren Impfstoff gegen ein neues Virus herzustellen, dauert normalerweise viele Jahre, manchmal gar Jahrzehnte.
Um mögliche Impfstoffe in kürzerer Zeit zu finden, werden heute sogenannte Impfstoff-Plattformen genutzt. Das Prinzip der Plattformen basiert auf dem Baukastenprinzip, bei dem gleiche Grundstrukturen und Technologien verwendet werden. (https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?cms_pos=2).
Plattformen nutzen insbesondere neben den oben beschriebenen Impfstoff-Klassen weitere Forschungsansätze:
- vermehrungsfähige oder vermehrungsunfähige Vektor-Impfstoffe,
- DNA- und
- RNA-Impfstoffe.
Vertiefende Erklärung:
Bei Vektorimpfstoffen wird der für die Impfung wichtige Teil des Erbguts des neuen Erregers in ein Trägervirus (z.B. Masernvirus) eingebaut. Das Trägervirus ist dann das Transportmittel (Vektor), das den Impfstoff in den Körper einschleust. Der Körper bildet Antikörper und kann das neue Virus abwehren.
Ein Vektor-Impfstoff ist beispielsweise der Ebola-Impfstoff.
RNA/DNA-Impfstoffe
Diese Impfstoffe enthalten nur Erbinformationen des neuen Virus. Nach der Impfung bilden Körperzellen dann selbst Virus-Eiweißstoffe. Diese Eiweißstoffe aktivieren das Immunsystem und erzeugen so die schützende Immunantwort.
DNA (Desoxyribonukleinsäure) speichert das Erbgut im Zellkern. RNA (Ribonukleinsäure) sorgt für eine genetische Informationsübertragung.
Welche Impfstoffe sind in Entwicklung?
Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählte im Oktober 2020 198 SARS-CoV-2–Impf-Projekte: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
Ob oder welches Projekt zu einem zugelassenen Impfstoff führen wird, ist nicht vorhersagbar.
Es ist auch unklar, wann und ob ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird.
Wann wäre ein neuer Impfstoff einsetzbar?
Die Impfstoffkandidaten, die eine gute Antikörperbildung auslösen, müssen sich in der Praxis bewähren. Die Testung erfolgt wie bei neuen Medikamenten üblich in mehreren Stufen.
In Phase 1 erhalten einige junge, gesunde Personen den neuen Impfstoff. Es wird erforscht, ob bzw. welche Nebenwirkungen auftreten.
Wenn Phase 1 erfolgreich verläuft, können mehrere hundert Personen geimpft werden.
Ziel ist, die optimale Dosis zu ermittelt (Phase 2).
In Phase 3 Studien wird der Impfstoff unter Alltagsbedingungen getestet. In dieser Phase werden in der Regel die Daten vieler tausend Personen über mehrere Monate ausgewertet.
Wegen der Dringlichkeit scheinen die Zulassungsbehörden bei potentiellen COVID-19-Impfstoffen das Zusammenlegen der Phasen 2 und 3 sowie eine kurze Beobachtungsperiode zu akzeptieren.
Angenommen, es gäbe einen Impfstoff:
Wer würde zuerst geimpft?
Die Impfstoffe müssten, zumindest in der Anfangsphase so eingesetzt werden, dass möglichst viele schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindert werden. Wie der bestmöglichste Nutzen mit welchem Impfstoff erreicht werden könnte, ist zurzeit unklar.
Zu berücksichtigen wären beispielsweise
- alters- und berufsspezifisches Infektionsrisiko
- Risiko für schwere Erkrankungen
- alters- und risikogruppenspezifisch erreichbarer Impfschutz
- Qualität des Impfschutzes (Verhinderung einer Infektion, Verhinderung eines schweren Krankheitsverlaufs, Anzahl der dafür notwendigen Impfdosen)
- Schutz medizinischer, pflegerischer und sicherheitsrelevanter Strukturen
Verfasser: Dr. Uta Butt im Auftrag des GPA

Empfehlen Sie uns!